INTERVIEW MIT ELISABETH STÖPPLER
ROTIERENDE GEWALT.
ÜBER DIE MÖGLICHKEIT, NICHT ZURÜCKZUSCHLAGEN
ÜBER DIE MÖGLICHKEIT, NICHT ZURÜCKZUSCHLAGEN
Regisseurin Elisabeth Stöppler im Gespräch mit Dramaturgin Anna Melcher.
Anna Melcher (AM): In welcher Welt begegnen wir Katerina Ismailowa, der ‚Lady Macbeth von Mzensk‘?
Elisabeth Stöppler (ES): Die Welt, in der Katerina als einzige weibliche Handlungsträgerin existiert, ist ein eindeutig männlich dominiertes System. Jede Person hat ihren Platz und hat zu funktionieren, zeichnet sich durch harte Arbeit aus und wird darin bestätigt, dass Leistung oberstes Gebot ist. Katerinas Funktion in dieser Welt ist die der Ehefrau, die ihren Ehemann zu unterstützen und ihm den Rücken freizuhalten hat. Dazu gehört, dass sie jederzeit sexuell verfügbar ist, dass sie keiner eigenen Arbeit nachgeht, keine eigenen Ansprüche zu stellen, sondern sich den Bedürfnissen ihres Mannes bedingungslos zu unterwerfen hat. Diese Welt meint eigentlich die von Nikolaj Leskow skizzierte vorrevolutionäre Zeit um 1860 in der russischen Provinz, von Dmitri Schostakowitsch Anfang der 1930er Jahre bereits interpretiert. Unsere Inszenierung zeigt Katerina und das sie umgebende System allerdings in unserer Zeit, nimmt Spielort und Handlung alles Ländliche und Folkloristische. Der äußere Dreck, dem der Hof der Ismailows ursprünglich anhaftet, ist bei uns einer klinischen, äußerlich unangreifbaren Oberfläche gewichen, unter der es lodert, brodelt und schmerzt. Das unerbittliche System lässt alle funktionieren und rotieren – bis Katerina es zu sprengen beginnt.
AM: In welchen Strukturen ist Katerina gefangen, von wem umgeben?
ES: Die Strukturen, die Katerina umgeben und bestimmen, sind eindeutig patriarchal. Ihre Verheiratung mit Sinowi Ismailowitsch durch den „Übervater“ Boris ist arrangiert und sieht vor, dass sie einen Erben für das Bestehen des Familienkapitals gebären muss. Doch Katerina und Sinowis Beziehung bleibt unfruchtbar – im grundsätzlichen Sinne, da weder körperliche Zuwendung noch geistige Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar bestehen, da er sie nicht schwängert, sondern schlägt, da er die Gewalt, die ihm von Kind an von seinem Vater angetan wurde, an seine Ehefrau weitergibt. Die Männer, die Katerinas Leben bestimmen, haben alle selbst Gewalt in familiären Strukturen erfahren. Auch Boris wurde von seinem Vater geschlagen und bestraft. Die Handlungstragenden des Stücks kennen also keine anderen Mittel, als über Züchtigung und Strafe andere zu dominieren und zu unterdrücken.
ES: Die Strukturen, die Katerina umgeben und bestimmen, sind eindeutig patriarchal. Ihre Verheiratung mit Sinowi Ismailowitsch durch den „Übervater“ Boris ist arrangiert und sieht vor, dass sie einen Erben für das Bestehen des Familienkapitals gebären muss. Doch Katerina und Sinowis Beziehung bleibt unfruchtbar – im grundsätzlichen Sinne, da weder körperliche Zuwendung noch geistige Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar bestehen, da er sie nicht schwängert, sondern schlägt, da er die Gewalt, die ihm von Kind an von seinem Vater angetan wurde, an seine Ehefrau weitergibt. Die Männer, die Katerinas Leben bestimmen, haben alle selbst Gewalt in familiären Strukturen erfahren. Auch Boris wurde von seinem Vater geschlagen und bestraft. Die Handlungstragenden des Stücks kennen also keine anderen Mittel, als über Züchtigung und Strafe andere zu dominieren und zu unterdrücken.
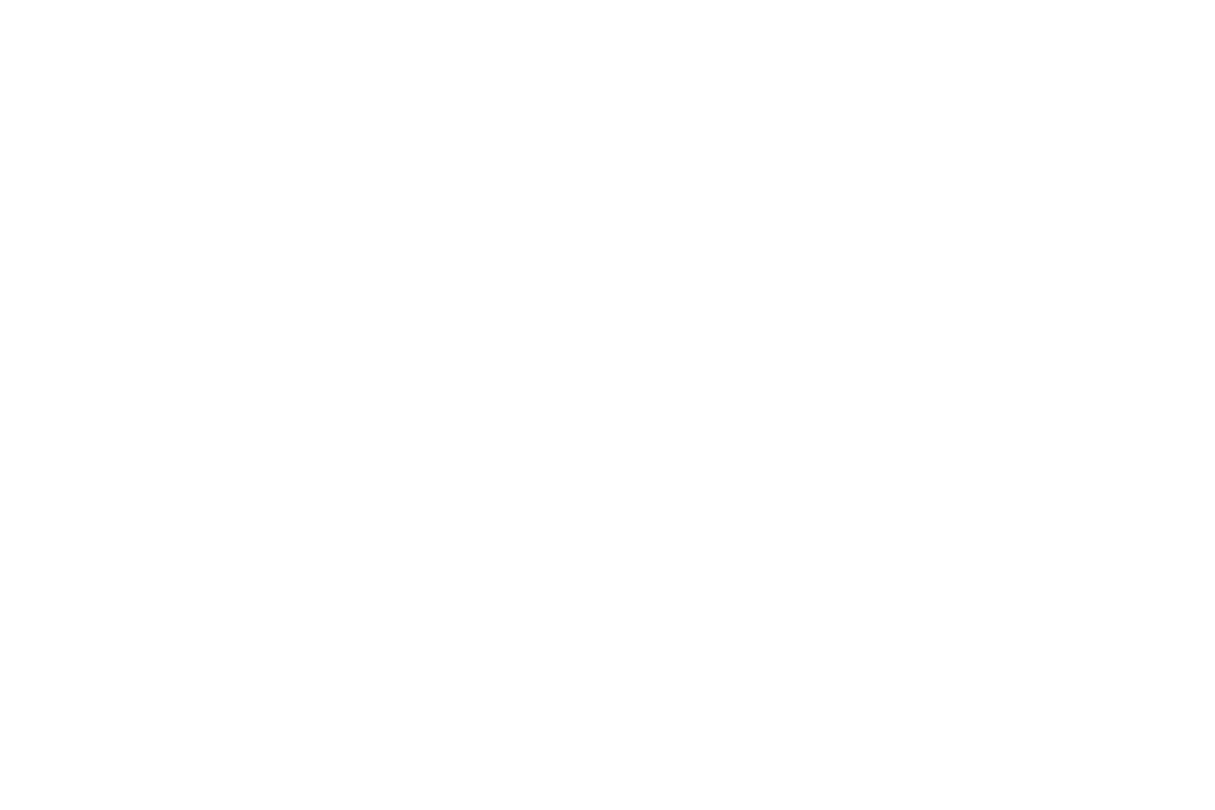
Izabela Matula (Katerina Ismailowa), Jussi Myllys (Sinowij Ismailow)
© Sandra Then
AM: Welche Energie treibt Katerina an?
ES: Musikalisch und textlich begegnen wir einer Frau, die voller Energie und Leidenschaft ist, von Sehnsucht und Gier nach Leben getrieben, jedoch in ihrem Leid implodiert, da sie keinen Weg findet, ihre innere und äußere Gefangenschaft aufzubrechen. Katerinas Leben ist bestimmt von Langeweile, Sinnlosigkeit und dem Gefühl, zu nichts nutze zu sein. Da sie in einem Gewaltsystem mitrotiert, in unserer Lesart selbst körperlicher Gewalt seitens ihres Ehemanns ausgesetzt ist, bleibt sie zunächst passiv. Die Gewalt lässt sie äußerlich versteinern, sie erträgt, statt sich zu widersetzen, aus Angst vor erneuter sexualisierter Gewalterfahrung. Ihr Bedürfnis nach Zärtlichkeit, ebenso wie ihre Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit und Freiheit spricht sie von Anfang an aus, bleibt aber mit diesen Gedanken allein – bis ihr Sergej begegnet.
ES: Musikalisch und textlich begegnen wir einer Frau, die voller Energie und Leidenschaft ist, von Sehnsucht und Gier nach Leben getrieben, jedoch in ihrem Leid implodiert, da sie keinen Weg findet, ihre innere und äußere Gefangenschaft aufzubrechen. Katerinas Leben ist bestimmt von Langeweile, Sinnlosigkeit und dem Gefühl, zu nichts nutze zu sein. Da sie in einem Gewaltsystem mitrotiert, in unserer Lesart selbst körperlicher Gewalt seitens ihres Ehemanns ausgesetzt ist, bleibt sie zunächst passiv. Die Gewalt lässt sie äußerlich versteinern, sie erträgt, statt sich zu widersetzen, aus Angst vor erneuter sexualisierter Gewalterfahrung. Ihr Bedürfnis nach Zärtlichkeit, ebenso wie ihre Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit und Freiheit spricht sie von Anfang an aus, bleibt aber mit diesen Gedanken allein – bis ihr Sergej begegnet.
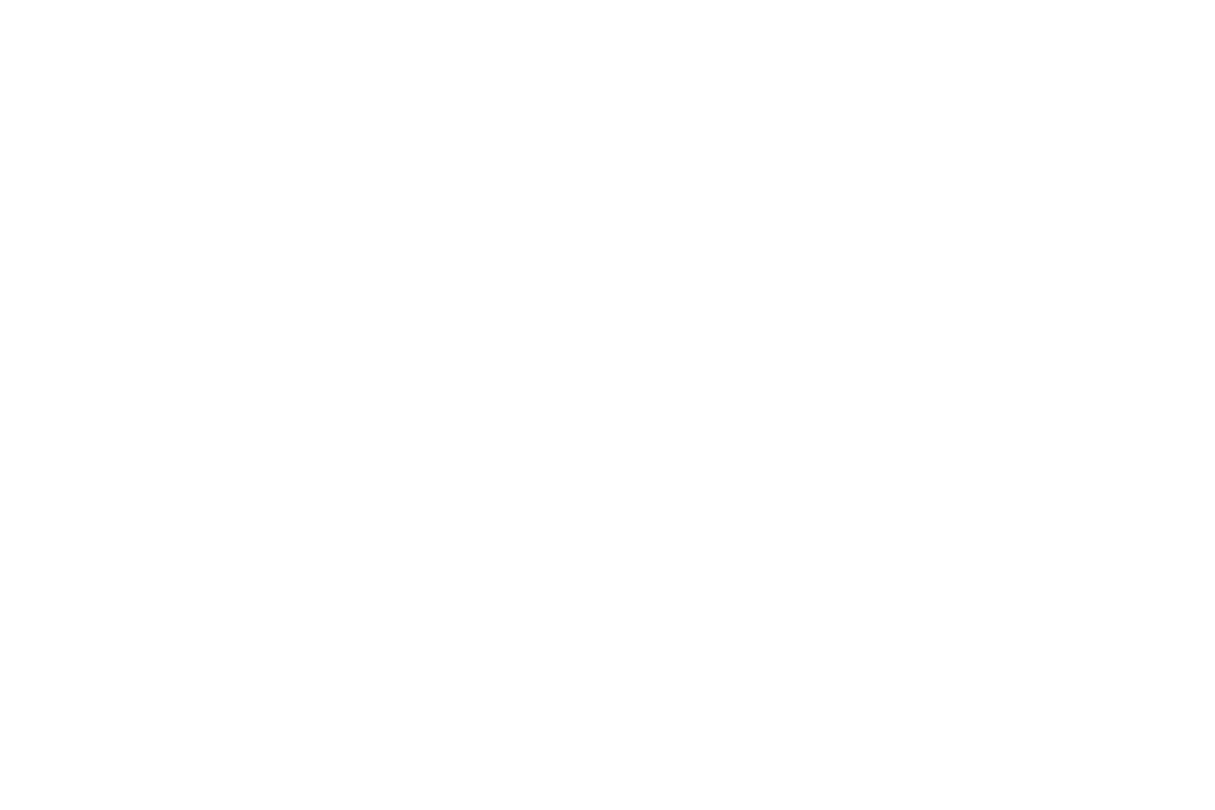
Izabela Matula (Katerina Ismailowa), Sergey Polyakov (Sergej), Torben Jürgens (Hausknecht/Alter Zwangsarbeiter), Sergej Khomov (Der Schäbige)
© Sandra Then
AM: Mit Sergej betritt ein Mann das Spielfeld, den Katerina als Vergewaltiger und Verführer kennenlernt – und mit dem es trotzdem sofort funkt. Dmitri Schostakowitsch schrieb in seinen Memoiren: „Um der Liebe willen war sie zu allem fähig, selbst zum Mord.“ Kommt hier tatsächlich Liebe ins Spiel? Was verbindet die beiden?
ES: Sergej und Katerina prallen auf- und entzünden sich aneinander. Sie scheinen sich zu kennen und ineinander zu spiegeln, kommen sie doch aus derselben Welt: Beide sind in Armut aufgewachsen, jenseits von liebevoller elterlicher Zuwendung eher durch abwesende Leitfiguren geprägt, intellektuell unterfordert und ohne Lebensziel. Katerina hat durch Heirat einen höheren sozialen Status erreicht, lebt im materiellen Wohlstand als „Luxusweibchen“; Sergej schlägt sich durch, lässt sich auf Frauen ein, die ihn anziehen und begehren. Beide langweilen sich, beide leiden an der Sinnlosigkeit ihrer jeweiligen Existenz. Sergej scheint jedoch frei und ungebunden – was Katerina instinktiv spürt und magisch anzieht. Diese Anziehungskraft ist komplett irrational. Katerina nimmt deshalb sofort unbewusst die Gefahr und das Risiko der Affäre in Kauf. So stürzen sie und Sergej ineinander – ob das Liebe meint, bleibt offen. Uns war wichtig, eine heftige gegenseitige Zuneigung und ein „Miteinander Müssen“ zu zeigen, auch um das Klischee von Sergej als ausschließlich berechnenden Mann aufzubrechen.
AM: Dmitri Schostakowitsch hat in seinen Aufzeichnungen zum Stück klar bekannt, dass seine Sympathien Katerina gelten. Ein gewinnender Charakter ist die gelangweilte Kaufmannsfrau kaum. Wie gehen wir mit ihr durch das Stück?
ES: Wir gehen mit Katerina durch ihren Alltag. Wir begegnen ihr in ihren Räumen, in ihrer Privatsphäre, die von Schwiegervater und Ehemann kontrolliert und unterlaufen wird. Gerade Boris verschafft sich permanent Zutritt zum ehelichen Schlafzimmer und beobachtet Katerina sogar im Schlaf. Es ist vorstellbar, dass er Sinowi bewusst wegschickt, um uneingeschränkten Zugriff auf die Ehefrau seines Sohnes zu haben. Katerina wird also durchgehend observiert, ist ständig männlichem Blick und Übergriff ausgesetzt. In dieser äußeren und inneren Gefangenschaft, die in ihrem vordergründigen Komfort wie ein „Goldener Käfig“ scheint, bewegt sie sich passiv und wie ferngesteuert. In den kurzen Momenten, in denen sie allein ist, versucht sie loszulassen, wird aber immer wieder gestört. Deshalb kommen wir ihr auch nie wirklich nah: Sie lässt sich letztendlich auch von Sergej dominieren, unterwirft sich ihm als Mann und seinen Bedürfnissen, läuft ihm verzweifelt hinterher, als er ihrer längst überdrüssig geworden ist und sie für eine andere Frau verrät. Dadurch, dass sie zur Mörderin wird, verliert Katerina am Ende vor allem eines: ihre innere Unschuld und Integrität. Daran geht sie kaputt. Sie wird sich bis zum Schluss nicht selbst befreien können, dazu fehlen ihr Kraft und Autonomie, weil sie sich von Sergej zutiefst abhängig gemacht hat.
ES: Wir gehen mit Katerina durch ihren Alltag. Wir begegnen ihr in ihren Räumen, in ihrer Privatsphäre, die von Schwiegervater und Ehemann kontrolliert und unterlaufen wird. Gerade Boris verschafft sich permanent Zutritt zum ehelichen Schlafzimmer und beobachtet Katerina sogar im Schlaf. Es ist vorstellbar, dass er Sinowi bewusst wegschickt, um uneingeschränkten Zugriff auf die Ehefrau seines Sohnes zu haben. Katerina wird also durchgehend observiert, ist ständig männlichem Blick und Übergriff ausgesetzt. In dieser äußeren und inneren Gefangenschaft, die in ihrem vordergründigen Komfort wie ein „Goldener Käfig“ scheint, bewegt sie sich passiv und wie ferngesteuert. In den kurzen Momenten, in denen sie allein ist, versucht sie loszulassen, wird aber immer wieder gestört. Deshalb kommen wir ihr auch nie wirklich nah: Sie lässt sich letztendlich auch von Sergej dominieren, unterwirft sich ihm als Mann und seinen Bedürfnissen, läuft ihm verzweifelt hinterher, als er ihrer längst überdrüssig geworden ist und sie für eine andere Frau verrät. Dadurch, dass sie zur Mörderin wird, verliert Katerina am Ende vor allem eines: ihre innere Unschuld und Integrität. Daran geht sie kaputt. Sie wird sich bis zum Schluss nicht selbst befreien können, dazu fehlen ihr Kraft und Autonomie, weil sie sich von Sergej zutiefst abhängig gemacht hat.
AM: Du hast unlängst „Macbeth“ von Giuseppe Verdi nach William Shakespeare inszeniert und dich auch dort mit einer ‚Lady Macbeth‘ auseinandergesetzt. Worin unterscheiden sich beide Figuren, gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten?
ES: Je länger ich mich mit der Schostakowitsch-Oper beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass beide Figuren unterschiedlich sind, sich in letzter Konsequenz jedoch extrem ähneln. Die Shakespeare-Lady unterstützt ihren Mann und treibt ihn mit ihrem Ehrgeiz und Hass in eine endlose Mordserie. Sie selbst tötet nie. Und dennoch zerbricht sie an den Verbrechen ihres Mannes, denn während Macbeth immer entschlossener und blutrünstiger wird, rauben ihr ihre Visionen von ewig blutigen Händen den Schlaf und machen sie zu einem Schatten ihrer selbst. Schostakowitschs Lady hat beim ersten Mord niemanden an ihrer Seite. Sie vergiftet ihren Schwiegervater, nachdem dieser Sergej beinahe totgeschlagen hätte. Ab diesem ersten Mord bereitet ihr der Geist des toten Boris schlaflose Nächte – sowie bei Shakespeare Macbeth von dem ermordeten Banquo heimgesucht wird. Wie die Shakespare-Lady wird sich Katerina von diesem „Sündenfall“ nicht mehr erholen. Das Töten zerrüttet sie seelisch und körperlich. Katerina ist also eine Mischung aus der männlichen und der weiblichen Hauptfigur des Shakespeare-Dramas, ein weiblicher Macbeth und eine mordende Lady Macbeth in einem.
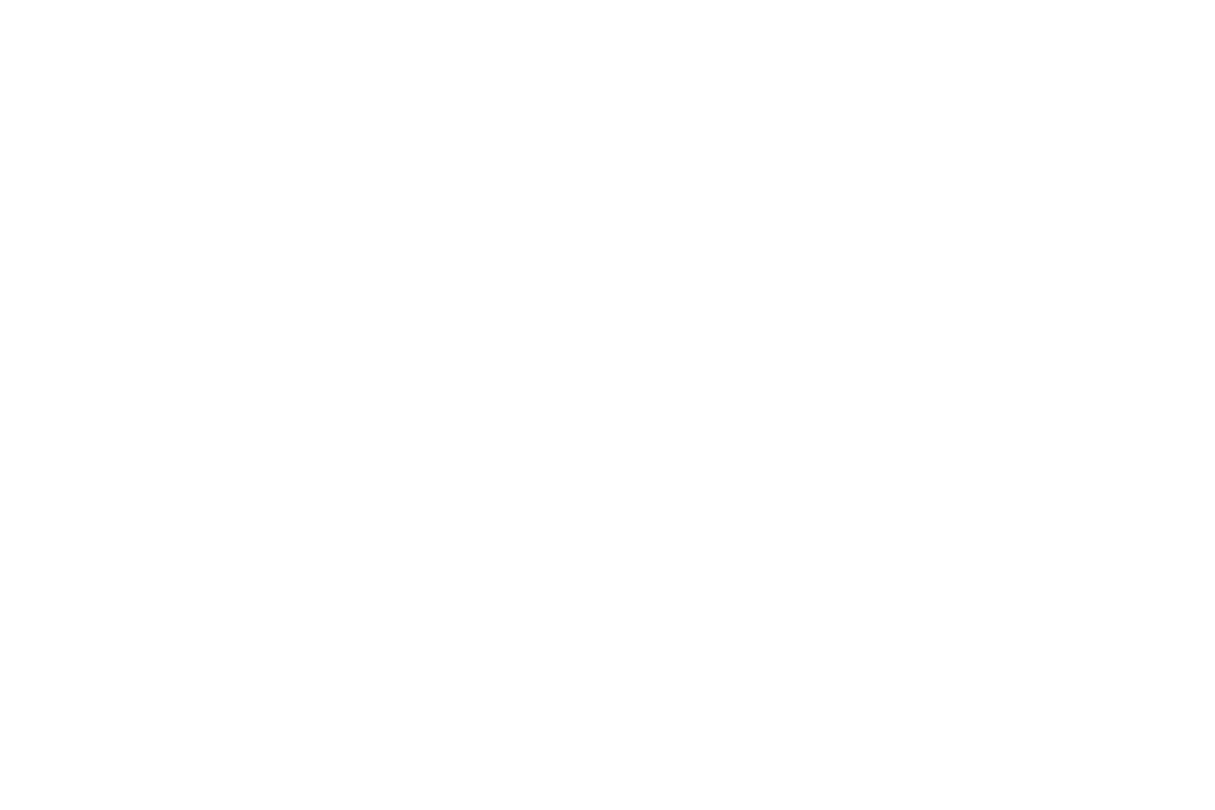
Andreas Bauer Kanabas (Boris Ismailow), Izabela Matula (Katerina Ismailowa)
© Sandra Then
AM: Dmitri Schostakowitsch hat seine Oper als tragisch-satirisch beschrieben. Die unmittelbare Nachbarschaft von Schrecken und Komik, von greller Groteske und fast zartem Innehalten, Satire und plakativ realistischer Vertonung verlangen den Ohren ständige Perspektivwechsel ab. Wie gehst du in der Bühnenerzählung damit um?
ES: Für mich beginnt das Stück geradezu filmrealistisch. Die Gemeinheit und Rohheit der Männer ist äußerst plakativ komponiert und trotzdem nachvollziehbar. Mit dem Popen taucht zum ersten Mal eine öffentliche Instanz auf, die in ihrer grenzenlosen Lächerlichkeit sicherlich als Satire auf die Kirche zu verstehen ist. Im dritten Akt komponiert Schostakowitsch mit dem Polizeichef eine weitere Karikatur, die die Verdorbenheit und Bigotterie der Staatsgewalt verkörpert. Richtig grell wird es erst, nachdem Katerina Boris vergiftet, gemeinsam mit Sergej ihren Ehemann erdrosselt und seine Leiche verschwinden lässt. Je mehr sich diese beiden Morde in ihr Gewissen brennen, desto „verrückter“ wird Katerina, desto hilfloser klammert sie sich an ihren Geliebten und Komplizen Sergej, der sie grausam fallenlassen wird. Wir gehen in unserer Erzählung mit diesem Zerfall mit und zeigen Katerina als immer groteskere, monströse Version ihrer selbst. Und noch etwas ist wichtig: In der Musik Schostakowitschs schwingt immer eine Ebene des Unheils, des Schmerzes und des Alptraums mit. Die Musik nimmt einen derart gefangen, dass einem das Lachen im Hals steckenbleibt.
ES: Für mich beginnt das Stück geradezu filmrealistisch. Die Gemeinheit und Rohheit der Männer ist äußerst plakativ komponiert und trotzdem nachvollziehbar. Mit dem Popen taucht zum ersten Mal eine öffentliche Instanz auf, die in ihrer grenzenlosen Lächerlichkeit sicherlich als Satire auf die Kirche zu verstehen ist. Im dritten Akt komponiert Schostakowitsch mit dem Polizeichef eine weitere Karikatur, die die Verdorbenheit und Bigotterie der Staatsgewalt verkörpert. Richtig grell wird es erst, nachdem Katerina Boris vergiftet, gemeinsam mit Sergej ihren Ehemann erdrosselt und seine Leiche verschwinden lässt. Je mehr sich diese beiden Morde in ihr Gewissen brennen, desto „verrückter“ wird Katerina, desto hilfloser klammert sie sich an ihren Geliebten und Komplizen Sergej, der sie grausam fallenlassen wird. Wir gehen in unserer Erzählung mit diesem Zerfall mit und zeigen Katerina als immer groteskere, monströse Version ihrer selbst. Und noch etwas ist wichtig: In der Musik Schostakowitschs schwingt immer eine Ebene des Unheils, des Schmerzes und des Alptraums mit. Die Musik nimmt einen derart gefangen, dass einem das Lachen im Hals steckenbleibt.
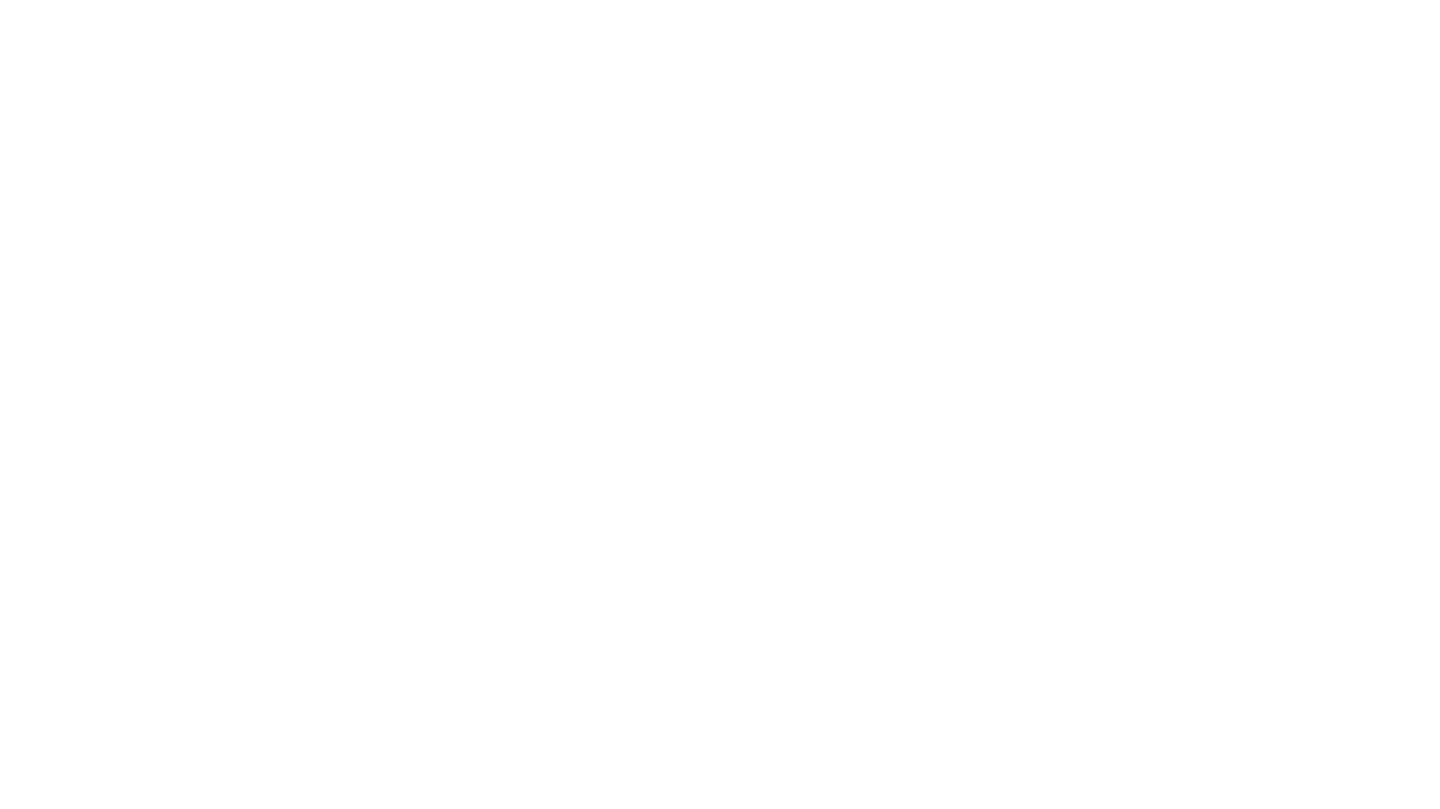
Izabela Matula (Katerina Ismailowa)
© Sandra Then
AM: 1939 schrieb Schostakowitsch in seinem Aufsatz „Musik im Kino“: „Ich träume zur Zeit davon, eine Filmoper zu schreiben, die nach allen Gesetzen des realistischen Musiktheaters geschaffen werden sollte. ... Welch eine dankbare Aufgabe für den Komponisten, den Rhythmus dieses dynamischen Stroms von Szenen einzufangen und eine Musik zu schreiben, die im Film gleichberechtigt handelt und zeitweilig sogar führt.“ Betrachtet man den Aufbau hinsichtlich der musikalischen Zwischenspiele in „Lady Macbeth von Mzensk“, kann man den Eindruck gewinnen, er habe diese Gedanken bereits bei dieser Komposition gedacht…
ES: Diese Oper funktioniert wie ein Sog. Die Zwischenspiele sind sowohl emotionale Brücken wie tiefe Abgründe zwischen den Szenen. Sie treiben die Handelnden voran und reißen uns als Zuhörende in ihrem gewaltigen Strom mit. Darauf aufbauend war für unsere Raum-Idee wesentlich, dass wir Katerina als Zuschauende immer ganz nahe sein wollten. Wir wollten sie auf Schritt und Tritt begleiten, sie wie eine Kamera verfolgen, wie unter einem Brennglas beobachten, auch hinter verschlossenen Türen. Hinzu kam die Idee, dass sich Katerina manchmal wie in einem inneren Film in ihren Albträumen verliert, dass sie um sich selbst rotiert, ohne jemals bei sich anzukommen. Dass sie sich in einem Teufelskreis befindet, in dem sie selbst schließlich nur noch destruktiv agiert.
AM: Wie funktioniert die Dramaturgie der Gewalt im Stück? Gibt es überhaupt einen Ausweg aus der Gewaltspirale?
ES: Das perfide Prinzip der Männer, die wir in Schostakowitschs Oper erleben, ist, die erlebte Gewalt unmittelbar weiterzugeben. Die Opfer von Gewalt werden oft selbst zu Täter*innen: Sie üben erneut Gewalt aus, um die eigene Schwäche und den eigenen Schmerz zu überwinden, indem sie andere beherrschen und demütigen. Katerina kennt kein anderes Mittel des Widerstands und der Gegenwehr als die Gewalt. Sie tötet und vernichtet schlussendlich diejenigen, die sie bei lebendigem Leib getötet und vernichtet haben. Am Ende schlägt auch sie nur noch wild um sich. Aber hätte sie nicht die Wahl zu verschonen, innezuhalten, loszulassen? Und vor allem: Muss sie sich wirklich am Ende selbst vernichten? Ich denke immer, eigentlich täglich: Eine*r muss den Anfang machen, eine*r muss nicht zurückschlagen, sondern aufhören, weiteratmen, weitergehen. Aus Mitgefühl, aus Liebe, warum auch immer. Es gibt unendlich viele Gründe, die anderen am Leben zu lassen und selbst am Leben zu bleiben.
ES: Das perfide Prinzip der Männer, die wir in Schostakowitschs Oper erleben, ist, die erlebte Gewalt unmittelbar weiterzugeben. Die Opfer von Gewalt werden oft selbst zu Täter*innen: Sie üben erneut Gewalt aus, um die eigene Schwäche und den eigenen Schmerz zu überwinden, indem sie andere beherrschen und demütigen. Katerina kennt kein anderes Mittel des Widerstands und der Gegenwehr als die Gewalt. Sie tötet und vernichtet schlussendlich diejenigen, die sie bei lebendigem Leib getötet und vernichtet haben. Am Ende schlägt auch sie nur noch wild um sich. Aber hätte sie nicht die Wahl zu verschonen, innezuhalten, loszulassen? Und vor allem: Muss sie sich wirklich am Ende selbst vernichten? Ich denke immer, eigentlich täglich: Eine*r muss den Anfang machen, eine*r muss nicht zurückschlagen, sondern aufhören, weiteratmen, weitergehen. Aus Mitgefühl, aus Liebe, warum auch immer. Es gibt unendlich viele Gründe, die anderen am Leben zu lassen und selbst am Leben zu bleiben.